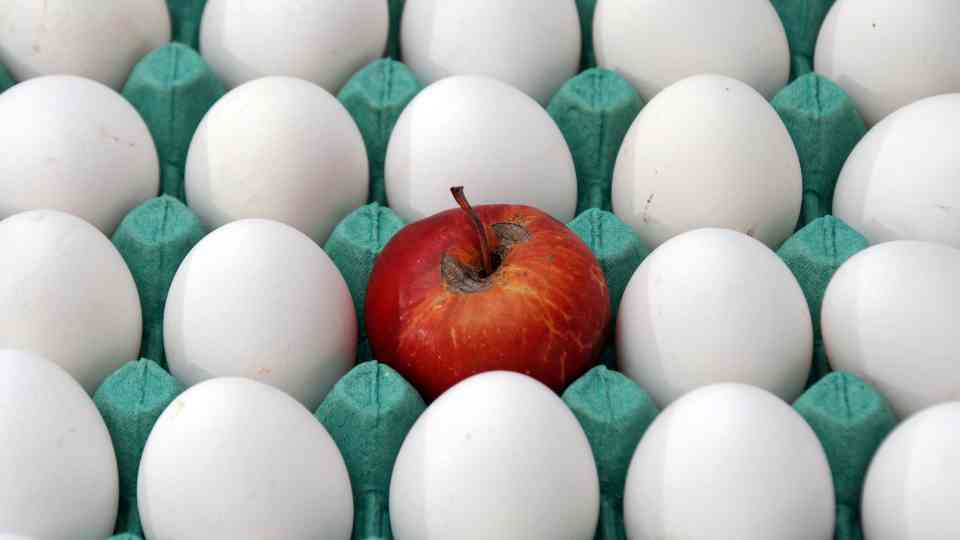Einleitung
Sexuelle Abweichungen und ihre wissenschaftliche Klassifikation haben eine lange Geschichte in der Psychologie und Medizin. Der Begriff „Perversion“ stammt aus dem Lateinischen pervertere und bedeutet „umkehren“ oder „verdrehen“. In der Alltagssprache wird er oft abwertend verwendet, um Sexualpraktiken zu bezeichnen, die nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen. Wissenschaftlich betrachtet hat sich die Bedeutung des Begriffs jedoch gewandelt. Moderne Klassifikationen, wie das DSM-5 und die ICD-11, sprechen heute vorwiegend von „Paraphilien“ oder „paraphilen Störungen“, um sexuelle Vorlieben zu beschreiben, die von der Norm abweichen.

Wir am Institut für Beziehungsdynamik
Das Berliner Institut für Beziehungsdynamik, gegründet 2006, bietet im Schwerpunkt Paartherapie, Sexualtherapie und Körperpsychotherapie an.
In diesem Beitrag untersuchen wir die historischen und modernen Konzepte von Perversion und Paraphilie, ihre psychodynamischen Hintergründe sowie diagnostische Kriterien. Dabei wird auch die Abgrenzung zwischen unproblematischen Paraphilien und klinisch relevanten paraphilen Störungen thematisiert. Wichtig hier ist: Dieser Artikel kennzeichnet keine moralische Haltung oder Bewertung, sondern soll eine Übersicht über gängige Sichtweisen liefern.
Sie suchen Unterstützung im Rahmen einer Einzeltherapie/ Psychotherapie oder Paartherapie? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
Historische Perspektive: Von Krafft-Ebing zu Freud
Der Psychiater Richard von Krafft-Ebing legte mit seinem Werk Psychopathia Sexualis (1886) die Grundlage für die wissenschaftliche Erforschung sexueller Abweichungen. Er definierte Perversion als Abweichung von der Fortpflanzungsfunktion der Sexualität und erstellte eine Typologie sexueller Abweichungen, darunter Fetischismus, Sadomasochismus und Homosexualität (Krafft-Ebing, 1886).
Sigmund Freud griff diesen Begriff auf, sah Perversionen jedoch nicht nur als pathologische Zustände, sondern als natürlichen Bestandteil der psychosexuellen Entwicklung. In seinen Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905) erklärte er, dass jedes Kind eine „polymorph-perverse“ Veranlagung habe, die in der normalen Entwicklung kanalisiert werde (Freud, 1905).
Freuds psychoanalytischer Ansatz hat bis heute Einfluss auf die psychodynamische Betrachtung sexueller Abweichungen, wurde jedoch im Laufe der Zeit durch empirische Forschung erweitert und in moderne Klassifikationssysteme integriert.
Moderne Klassifikationen: Paraphilien und paraphile Störungen
Heute spricht man in der klinischen Psychologie nicht mehr von „Perversionen“, sondern von „Paraphilien„. Laut DSM-5 ist eine Paraphilie definiert als eine „intensive und anhaltende sexuelle Neigung oder Erregung durch ungewöhnliche Objekte, Situationen oder Personen“. Dabei wird zwischen harmlosen Paraphilien und paraphilen Störungen unterschieden.
Diagnostische Kriterien nach DSM-5

Das DSM-5 (2013) unterscheidet zwischen bloßen Paraphilien und paraphilen Störungen. Letztere liegen vor, wenn eine oder mehrere der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- Die sexuelle Vorliebe verursacht erheblichen Leidensdruck oder Einschränkungen im Alltag.
- Die Praktiken beinhalten nicht-einvernehmliche Personen oder fügen anderen Schaden zu.
Beispielsweise ist Fetischismus als sexuelle Neigung für unbelebte Objekte oder Körperteile nicht zwangsläufig eine Störung. Wird der Fetisch jedoch zur Voraussetzung für sexuelle Erregung und beeinträchtigt das Sozialleben, kann eine Diagnose gestellt werden (APA, 2013).
Die ICD-11 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Paraphilien ähnlich und legt ebenfalls Wert darauf, zwischen harmlosen Neigungen und behandlungsbedürftigen Störungen zu unterscheiden (WHO, 2019).
Beispiele für Paraphilien
hier einige Beispiele für Paraphilien.
Fetischismus
Fetischismus beschreibt die sexuelle Erregung durch unbelebte Objekte oder spezifische Körperteile. Studien zeigen, dass Fetischismus häufig vorkommt, aber nur selten mit Leidensdruck verbunden ist (Scorolli et al., 2007).
Voyeurismus
Voyeurismus beschreibt das heimliche Beobachten von Menschen in intimen Situationen. Laut Studien sind voyeuristische Neigungen weit verbreitet, aber nur dann pathologisch, wenn sie zwanghaft ausgeübt werden oder gegen den Willen der beobachteten Personen erfolgen (Langström & Seto, 2006).
Sadomasochismus
BDSM-Praktiken (Bondage, Dominanz, Submission, Sadismus, Masochismus) sind in den meisten Fällen einvernehmlich und nicht pathologisch. Die DSM-5-Diagnose einer „sexuell sadistischen Störung“ setzt voraus, dass nicht-einvernehmliche Handlungen oder erheblicher Leidensdruck vorliegen. Empirische Studien zeigen, dass viele BDSM-Praktizierende ein hohes psychisches Wohlbefinden aufweisen (Weinberg et al., 1994).
Psychoanalytische Perspektiven auf Perversion
Innerhalb der Psychoanalyse gibt es verschiedene Theorien zur Entstehung von Perversionen. Freud sah sie als Abwehrmechanismus gegen innere Konflikte. Spätere Theoretiker wie Stoller (1975) interpretierten Perversion als „erotisierten Hass“, bei dem unbewusste Aggressionen gegen frühkindliche Bezugspersonen sexualisiert werden (Stoller, 1975).
Für uns am Institut für Beziehungsdynamisch ist diese Sicht hilfreich für die sexual- oder beziehungstherapeutischen Prozess – keinesfalls sprechen wir hier von der Wahrheit.

Perversion – als erotisierter Hass
Es ist wichtig zu sehen, dass die psychoanalytische Perspektive auf Perversion sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat und mittlerweile bietet diese Sicht verschiedene Erklärungsansätze für dieses komplexe Phänomen.
Psychoanalytiker sehen Perversion oft als Resultat frühkindlicher Traumata. Wolfgang Berner argumentiert, dass Perversionen verschiedene Funktionen erfüllen können, wie etwa die Abwehr von Intimität und engen Bindungsbedürfnissen1. Robert Stoller vertritt die These, dass der Perversion ein in der Kindheit erlittenes Trauma zugrunde liegt, welches Feindseligkeit hervorgerufen hat. Diese Feindseligkeit entlädt sich später im Rahmen der Perversion, in der Hoffnung, frühe Wunden zu heilen.
Stoller beschreibt Perversion als „erotisierten Hass“. In der perversen Handlung wird das ursprüngliche Trauma in der Phantasie in einen Triumph umgewandelt, wobei ein gewisses Risiko bestehen bleibt, sich erneut im Trauma zu verstricken. Die Bedrohung der eigenen Geschlechtsidentität spielt dabei eine zentrale Rolle. Der perverse Akt dient dazu, eine bedrohliche Situation aufzusuchen und in einen Triumph zu verwandeln, oft ausgelöst durch aktuelle Kränkungen der Identität.
Die Bedeutung der Perversion
Franco De Masi betont die Komplexität des Themas und die Uneinigkeit innerhalb der psychoanalytischen Gemeinschaft bezüglich der Natur und Bedeutung von Perversionen (Quelle). Er untersucht Verbindungen zwischen sadomasochistischer Perversion und anderen psychischen Zuständen wie Depression, Borderline-Störungen und Psychosen.
Kritik am Perversionsbegriff
Moderne psychoanalytische Ansätze hinterfragen zunehmend die pathologisierende Bedeutung des Perversionsbegriffs (Quelle). Einige Analytiker verzichten ganz auf die Behandlung dieses Themas in Lehrbüchern, während andere den Begriff als technischen Terminus in spezifischen psychoanalytischen Konstrukten verwenden (Quelle).
Die psychoanalytische Perspektive auf Perversion bleibt ein komplexes und kontroverses Feld, das weiterhin Gegenstand von Forschung und Diskussion ist. Die verschiedenen Ansätze reichen von klassischen Erklärungsmodellen bis hin zu kritischen Neubetrachtungen, die die pathologisierende Sichtweise in Frage stellen.
Fazit
Die Begriffe „Perversion“ und „Paraphilie“ haben sich im Laufe der Zeit gewandelt. Während Perversion früher als moralisches oder pathologisches Urteil verstanden wurde, hat sich die wissenschaftliche Sichtweise differenziert. Moderne Psychiatrie und Psychoanalyse unterscheiden zwischen harmlosen Paraphilien und paraphilen Störungen, um zwischen individuellen Neigungen und problematischen Verhaltensweisen zu differenzieren.
Psychologische Forschung zeigt, dass viele Paraphilien keine negativen Auswirkungen haben, solange sie einvernehmlich sind und nicht mit Leidensdruck verbunden sind. Dennoch bleibt das gesellschaftliche Verständnis von Sexualität dynamisch, und was heute als akzeptabel gilt, kann sich in Zukunft weiterentwickeln.